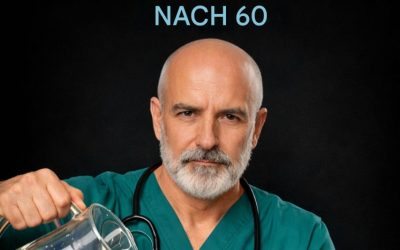Hannah war acht Jahre alt. Sie hatte meine dunklen Haare und die ruhigen Augen ihrer Mutter. Seit dem Tod ihrer Mutter zwei Jahre zuvor nach langer Krankheit hatte sie sich verändert. Sie sprach weniger. Sie lächelte weniger. Alle Fachleute sagten mir dasselbe: Kinder trauern in ihrem eigenen Tempo.
Ich stürzte mich in die Arbeit. Lange Arbeitszeiten. Späte Nächte. Ich redete mir ein, es sei notwendig. Ich tat es für sie. Für ihre Schule. Für Stabilität. Für die Zukunft, die sich ihre Mutter gewünscht hätte.
Das war der Zeitpunkt, als Melissa in unser Leben trat.
Sie wirkte damals perfekt. Organisiert. Elegant. Ruhig. Sie sprach freundlich mit Hannah, half bei den Hausaufgaben und bereitete Lunchpakete zu. Als wir im darauffolgenden Jahr heirateten, war ich erleichtert, fast stolz auf mich selbst.
„Sie braucht eine Mutterfigur“, sagte ich mir.
„Jetzt wird alles gut.“
Ich fragte mich nicht, warum Hannah nicht mehr zur Tür rannte, wenn ich nach Hause kam. Ich fragte mich nicht, warum sie selbst bei warmem Wetter lange Ärmel trug. Ich fragte mich nicht, warum sie Melissa immer ansah, bevor sie einen Bissen aß.
Ich habe Bequemlichkeit dem Bewusstsein vorgezogen. Und ich habe es bitter bereut.
Im Krankenhaus
Der Geruch von Desinfektionsmittel schlug mir sofort entgegen, als ich durch die automatischen Türen trat. Ich eilte zur Rezeption und rief den Namen meiner Tochter.
Der Blick der Krankenschwester veränderte sich, als sie mich ansah. Nicht nur Besorgnis. Etwas Düstereres.
„Kindertrauma-Einheit. Dritter Stock.“
Trauma.
Die Aufzugfahrt schien endlos. Als sich die Türen öffneten, wartete ein Arzt auf mich.
„Bevor Sie hineingehen“, sagte er sanft, „müssen Sie vorbereitet sein. Sie ist bei Bewusstsein, aber sie hat starke Schmerzen.“
Lesen Sie weiter, indem Sie unten auf die Schaltfläche ( NÄCHSTE SEITE 》 ) klicken!